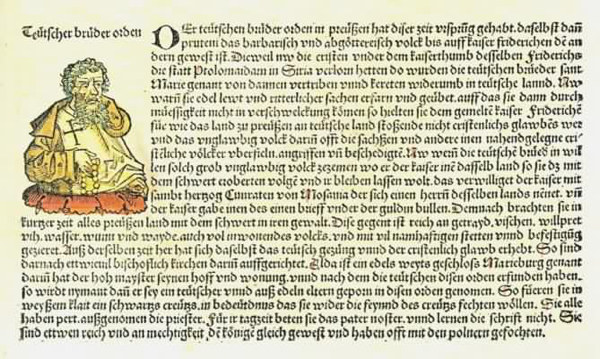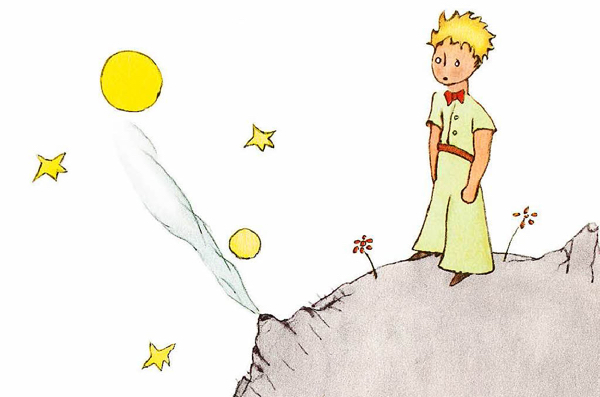Heute möchte ich an einen Mann erinnern, den die Idee einer supranationalen Organisation der europäischen Staaten seit seiner früher Jugend in seinem Herzen bewegte, für die er in seinem erwachsenen Leben zielstrebig arbeitete, sehr viel erreichte und dabei großen Erfolg hatte, aber konsequent das Licht der Öffentlichkeit scheute. Ich erinnere heute an Josef Hieronim Retinger.
„Paradox ist, dass er Europa in das 21. Jahrhundert gestoßen hat, obwohl er in der Manier des 19. Jahrhunderts agiert hat. Vielleicht war es so, weil die Idee des vereinigten Europas in ihrem Geiste so romantisch ist.“1
„Josef Retinger, wie ein Regisseur, brauchte andere als Akteure, sich selbst stets als graue Eminenz positioniert hat, als Mensch hinter der Bühne.“2
Wahrscheinlich gerade deshalb konnte er so viele einflussreiche Menschen erreichen. Er ist in die Geschichte eingegangen als jemand, der früh die Notwendigkeit der atlantischen Gemeinschaft sah, der auf die Entstehung einer supranationalen formalisierten Organisation arbeitete.

Josef Hieronim Retinger ist im Jahr 1888 in Krakau, Österreich-Ungarn3, geboren und 1960 in London gestorben. Vorfahren von Retinger kamen nach Polen Ende des 17. Jahrhundert aus Bayern. Sein Vater, Josef Stanislaw Röttinger war ein bekannter, sozialengagierter Rechtsanwalt in Krakau, seine Mutter, Maria Krystyna war Tochter von Emilian Czyrniański, Rektor der Jagiellonen-Universität. Josef Stanisław Röttinger war stark beteiligt an einem bekannten Prozess, der in letzter Instanz in den kaiserlich-königlichen Institutionen der habsburgischen Monarchie seinen Ausgang fand. Der begabte und an allem interessierte junge Josef Hieronim konnte die Bedeutung und hohe Effektivität der supranationalen Institutionen sehen und schätzen lernen, was mit großer Wahrscheinlichkeit Einfluss auf die Wahl seines Lebensweges hatte.
Ich springe zum Jahr 1960, dem Jahr seines Todes. Hier zitiere ich aus einem Brief den Sir E. Beddington-Behrens an die Times von 13. Juni 1960, einen Tag nach seinem Tod, schrieb:
„Joseph Retinger, der gestern verstarb, war zuerst als ein Schriftsteller über [Joseph] Conrad und sein Werk bekannt. Während des Krieges wurde er die ‚Graue Eminenz’ von General Sikorski genannt und wurde berühmt für seinen Fallschirmabsprung über Polen im Alter von 56 Jahren… Er war ein selbstloser, engagierter Mann, der nie sich selbst vorschlug, sondern sich damit begnügte, Männer zusammenzubringen, von denen er glaubte, sie würden seine Ideale teilen und könnten zusammen arbeiten, um seine kreativen politischen Konzepte voranzubringen. Er war dieses äußerst seltene Geschöpf, ein ‚politischer Förderer’, und sobald eine neue Idee angestoßen worden war und Fuß gefasst hatte, begnügte er sich damit, ihr von den Seitenlinien weiterzuhelfen, anderen das Rampenlicht der unmittelbaren Leitung überlassend. Er war es, der die Schaffung der Europäischen Bewegung anregte, die den Europarat4 herbeiführte. Die ganze Entwicklung der Idee der Einheit von Europa, die Schaffung des Europäischen Binnenmarktes und EFTA5 [Europäische Freihandelsassoziation] sind nur einige ihrer politischen Folgeerscheinungen…
Abgesehen von der Europäischen Bewegung, deren Ziele weitgehend propagandistisch und politisch sind (!), ‚war er es, der die European League for Economic Cooperation6 (ELEC) erschuf… Er regte die Gründung der Zentral- und Osteuropäischen Kommission der Europäischen Bewegung an… Er gründete später die (transatlantische) Bilderberg-Konferenz. Diese Konferenzen brachten führende Staatsmänner zusammen, die ihre Probleme im Privaten besprechen und Standpunkte mit Männer in wirklich hohen Stellungen in anderen Ländern austauschen konnten. Es war Joseph R., der sie zusammenbrachte und sie alle persönlich kannte. Ich bin ziemlich viel mit J. R. herumgereist, seine Freundschaften in hohen Positionen waren außergewöhnlich. Ich erinnere mich, wie er in den USA zum Telefonhörer griff und sogleich ein Verabredung mit dem Präsidenten traf, und in Europa hatte er kompletten Zutritt in alle politischen Kreise, wie eine Art von Anrecht, erworben (durch) das Vertrauen, die Ergebenheit und die Loyalität, welche er hervorrief. Mit seinem Ableben hat Polen einen großen Patrioten verloren, und Großbritannien und die freie Welt den Anreger von Beweggründen, die weitreichende Auswirkungen auf die Geschichte unserer Zeit haben werden.”
Lord Boothby schrieb:
„Wenn ein Europäischer Staatenbund zustande kommt, wie es ganz gewiss geschehen wird, wird er seiner (Retingers) Pionierarbeit viel zu verdanken haben. Immer treu zu Polen, zu Sikorski und zu seinen Freunden, von denen ich stolz bin einer gewesen zu sein, galt seine endgültige Treue der Konzeption eines Vereinten Europas…”
Und Mr. G. de Freitas, The Times, 13. Juni 1960:
„Sir E. Beddington-Behrens und Lord Boothby haben zu recht Dr. Retingers Arbeit für die europäische Einheit betont. Aber in den letzten Jahren ist er zu der Ansicht gelangt, dass Europa und Nordamerika sich gegenseitig benötigten, und er hat so hart und gewissenhaft für die Atlantische Gemeinschaft gearbeitet, wie er zuvor für die Europäische Bewegung gearbeitet hat. In dem Jahr vor dem Atlantischen Kongress, der in London abgehalten wurde, war Dr. Retinger ein Mitglied des internationalen Organisationskomitees. Mitglieder dieses Komitees lernten seinen Rat zu schätzen und sein bemerkenswertes Wissen über Personen des öffentlichen Lebens in den atlantischen Ländern zu würdigen… Er blieb ‚staatenlos’, da er glaubte, es verleihe ihm größere Freiheit bei seiner internationalen Missionarstätigkeit.”
Zurück zu seinen Jugendjahren: Josef Retinger wird streng katholisch und sehr patriotisch erzogen. Polen, geteilt zwischen Russland, Preußen und Österreich existiert nur im nationalen Bewusstsein. Seine Eltern und Großeltern waren sehr stark engagiert im Kampf gegen die Teilungsmächte, so prägt die patriotische Atmosphäre zu Hause und im Land den Jungen und seine Geschwister. Die Erziehung und die schulische Bildung werden von Tradition, vergangenem Ruhm, verlorenen Träumen beherrscht.
Besonders begabt und frühreif empfindet der junge Retinger das Leben in Krakau als langweilig, hoffnungslos ohne Zukunftschancen. (…) „Ich wünschte mir, dass Polen wieder frei ist, so, dass ich endlich kein verdammter Patriot sein muss…“, sagt er später.
Im Nachhinein schreibt er über seine Dilemmata: „Ich wollte nicht mit Tradition und der Vergangenheit brechen, jedoch der junge und aktive Geist drängte mich, neue, weite Horizonte zu suchen und das moderne Leben der Europäer kennen zu lernen. Trotz allem wollte ich mein ganzes Wirken dem Vaterland widmen.“
Josef Hieronim beendet das Gymnasium der Heiligen Anna in Krakau mit Auszeichnung. Durch Empfehlung wird er als Novize bei den Jesuiten in Rom aufgenommen, in Erwartung der Aufnahme in die Academiae Nobili Ecclesiastici, die viele Diplomaten absolvierten. Die strengen Regeln des Ordens waren jedoch für ihn nicht das Wahre. („Die Welt ist verlockender als das Jenseits!“) Dank der Empfehlung und eines Privatstipendiums kann er in Paris mit dem Studium an der École des Sciences Politiques und der Literatur an der Sorbonne beginnen. Durch viele Beziehungen ergibt sich für ihn die Gelegenheit in der Welthauptstadt viele außergewöhnliche Menschen kennen zu lernen. Paris der Belle Époque, seine Künstler, Aristokraten, Politiker, die er kennen lernt, werden für ihn auf seinem weiteren Weg sehr förderlich. Der einflussreiche Markiz de Castellane, bei dem er oft zu Gast war, beeindruckt ihn sehr. Und das war gerade de Castellane, der ihn inspiriert: man sollte endlich – es war die Zeit des I. Weltkrieges – über ein politisches Bündnis in Europa nachdenken und solches anstreben.
Sein Studium vernachlässigt er nicht. Nach zwei Jahren stellt er seine Doktorarbeit „Le conte fantastique dans le romantisme français“ vor und wird als der jüngste in Europa Doktor der Philologie in die Geschichte eingehen. Er baut sein Studium in München aus: hier studiert er die Vergleichende Psychologie der Völker, in London hört er in School of Economics Vorlesungen. 1910 in Paris veröffentlicht er sein erstes Buch: „L’Histoire de la littérature française depuis le romantisme jusqu’à nos jours“.
Im Jahr 1912 ist Retinger zurück in London und hier nimmt er seine politische Arbeit auf.
Bald wird er an geheimen Verhandlungen für einen gesonderten Frieden mit Österreich teilnehmen. Dies ist ein komplexes Thema, weil damit der so genannte Habsburg- oder Ledóchowski-Plan zu tun hat. Dieser Plan wollte für das Haus von Habsburg einen Staatenbund aus römisch-katholischen Ländern in Zentral- und Osteuropa arrangieren. Um dieses Ziel zu erreichen, macht sich Retinger zusammen mit Prinz Sixtus von Bourbon-Parma auf, den General in seiner jesuitischen Festung zu besuchen, dem Schloss zu Zizers, nahe Chur. Da Graf Ledóchowski zu dem Freundeskreis von Retingers Vormund gehörte, empfängt er ihn sehr freundlich und darüber hinaus erweist sich als der geeignetste Verhandlungsführer. Der Ledóchowski-Habsburg-Plan erhält die Unterstützung der spanischen Laienorganisation Opus Dei7.
1916 ist Retinger mit Unterstützung von Georges Clemenceau an einem Versuch der Friedensgespräche mit Wien beteiligt. Es geht um einen separaten Frieden mit Österreich. Es ist jedoch nicht möglich, weil die Wiener Administration nicht völlig frei von preußischen Angehörigen war. Der Kaiser ist geneigt, den Frieden zu unterschreiben, aber er kann es nicht ohne das Wissen der Preußen tun. Retingers Mission ist also nicht zu erfüllen.
Außerdem, noch während des I. Weltkrieges, in London lebend, widmet er sich ausschließlich politischer Tätigkeit: es geht um die polnische Sache im Westen. Josef Conrad, sein enger Freund, unterstützt ihn finanziell und auch dadurch, dass er ihn mit vielen Menschen, die in dieser Sache behilflich sein könnten, bekannt macht. Retinger reist zwischen London, Paris, der Schweiz und den Vereinigten Staaten.
Jedoch ist die westliche Öffentlichkeit an der Sache nicht interessiert; Polen war für England zu dieser Zeit ein Element der russischen Innenpolitik.
Friedensverhandlungen und die polnische Sache liegen zwar im Zentrum Retingers Interessenbereich. Aber auch das jüdische Problem bleibt lange in seinem Interessenfeld. Er hat die Idee, den europäischen Juden internationalen Status zu geben, da diese keine geschützte Minderheit sind und dazu überall diskriminiert. In dieser Mission trifft er sich unter anderen mit Chaim Weizmann, Wladimir Żabotycki, Nahum Sokolow und anderen zionistischen Aktivisten.
Gerade in dieser Zeit beginnt er sich für die Idee der europäischen Einheit zu interessieren. Zu Beginn des Jahres 1917 lernt er Arthur Capel kennen. Capel verbreitet die Idee einer Weltregierung, die auf der französisch-englischen Allianz aufgebaut werden sollte.
Retinger, mit allen wichtigen Persönlichkeiten Westeuropas vertraut, reist also unentwegt durch Europa.
An der Idee der Weltregierung zeigen Briand, Clemenceau und Wilson ihr Interesse. Auch in der Sache reist Retinger also beharrlich durch Europa. Das ermöglicht und erleichtert ihm die Bekanntschaft und bringt eine gewisse Vertrautheit mit allen wichtigen Personen Westeuropas.
Retinger und Capel haben gemeinsam bis zum Capels Tod (1919) an dem Buch The World on the Anvil gearbeitet. Retinger ist der Meinung, dass Capel zum Entstehen von Völkerbund beitrug und dass seine föderalistischen Ideen dann nach dem II. Weltkrieg wieder interessant werden konnten.
Es naht das Jahr 1939. Nach der September-Niederlage wird Władyslaw Sikorski erst Kommandeur der Armee, dann Premierminister der Exilregierung in Frankreich. In England wird Churchill der Premierminister. Im Frühling 1940 kapituliert Frankreich. Polnische Armee in Frankreich zerstreut sich, die Exilregierung zieht nach Angers und weiter nach Bordeaux. Retinger, die verzweifelte Lage sehend, wirbt bei Churchill um Hilfe bei der Evakuierung der Regierung und der Exilarmee nach England.
Retinger findet Sikorski in Libourne und überzeugt ihn zu seinen Plänen. Bald befinden sich in England bis an die 80 000 Soldaten, denen sich in kurzer Zeit die Armee von General Anders anschließt, worin auch Retinger eine Rolle spielt. Die polnische Luftwaffe, die in der Schlacht um England eine große Bedeutung haben wird, kommt dazu.
Seit dieser Zeit steht Retinger Sikorski sehr nahe, ist die graue Eminenz in seiner Umgebung. Es ist auch Sikorski, der Retinger den Beinammen „Teufels Cousin“ verpasst.
Warum „Teufels Cousin“? Weil Retinger für jedes Problem tausende Ideen hat, unglaublich viele Beziehungen, Bereitschaft zum sofortigen – nach dem Erkennen des Problems – Unterbreiten der Lösungsmöglichkeiten und zum Handeln.
Sikorski und Retinger kennen sich seit 1916. Schon damals half ihm Retinger, Kontakte zu englischen Politikern zu knüpfen. Retinger will Sikorski für die Idee, einer polnisch-tschechisch-slowakischen Union als Gegengewicht zu einerseits Deutschland, andererseits zu Sowjetunion gewinnen. Diese Idee, früher schon von Piłsudski ins Auge gefasst und vorangetrieben, verfolgt Retinger seit etwa 1940. Ihn hatte seine absolut positive Erfahrung aus der Zeit der Habsburger Monarchie für die Idee eines supranationalen Staatenverbund überzeugt. Weiter sollte dieser Staatenverbund um Litauen, Rumänien, Ungarn und Ukraine erweitert werden. Die Hoffnung, da könnte sich die Chance bieten, weitere Länder, wie Jugoslawien, Bulgarien, Albanien und die Türkei zu gewinnen, steht im Raum. Das könnte also eine Union der Länder zwischen Baltikum, dem Schwarzen Meer und dem Adriatischen Meer werden – genannt Intermarium8. Diese Union sollte gemeinsame Außenpolitik führen und eine gemeinsame Armee ins Leben rufen, sowie eine Zollunion, die die Wirtschaft integrieren würde. Die Länder behielten eigenes politisches System und eine Autonomie. Damit sollte der Grundstein für eine mitteleuropäische Föderation kleinerer Staaten gelegt werden.
Auch Sikorskis Interesse an diesem Konzept war groß, denn es war fraglos, dass die internationalen Beziehungen in Mittel- und Osteuropa neu gestaltet werden müssen. Retinger, jetzt offiziell als Berater des Ministerpräsidenten, und Sikorski führen Gespräche mit dem tschechoslowakischen Präsidenten Beneš, mit Hubert Ribka und Jan Masaryk. Diese Pläne und Gespräche verfolgt auch mit einigem Interesse die britische Regierung, die in solchem Staatengebilde eine Stabilisierung der Lage in diesem Teil von Europa für möglich hält.
Polnisch-tschechische Gespräche über die Föderation münden am 21. Mai 1941 in einem Gründungsakt des Verbundes von Polen und der Tschechoslowakei. Dieser Gründungsakt hat die Form eines Grundgesetzes. Aber als die Sowjetunion sich den Alliierten anschließt, ändert die tschechische Seite ihr Verhältnis zu der geplanten Föderation und zugleich zu der Sowjetunion. Die pragmatischen tschechischen Politiker sind der Meinung, dass eine Unterstützung seitens der Sowjetunion günstiger sein wird als eine Föderation mit Polen.
Des Weiteren ermöglicht Retinger seine Funktion als Berater des Ministerpräsiden in Exil Sikorski den Boden für Gespräche mit den führenden Köpfen anderer europäischer Staaten zu bereiten. Am 7. Februar 1941 findet ein weiteres Gespräch statt. Er bringt die polnische Delegation unter Führung von Sikorski mit den Politikern der belgischen Exilregierung – dem Premierminister Paul-Henri Spaak, dem Minister Marcel-Henri Jaspar, mit Roger Motz und Paul van Zeeland – zusammen.
So schaut Retinger auf dieses Ereignis zurück: „Ich erinnere mich an das Datum, denn später, sowohl Jaspar als auch Spaak sagten, dass sie dieses Gespräch in ihren Memoiren vermerkt haben als eines der wichtigsten und interessantesten, welche sie in dieser Zeit führten.“
Wenige Monate später trifft die polnische Delegation auf die holländische. An dem Gespräch nimmt Pieter Kerstens, der niederländische Senator und ehemalige Wirtschaftsminister teil. Er kann voll für die Idee der europäischen Einheit gewonnen werden und wird in Zukunft ein großer Fürsprecher dieser Bewegung und Freund von Retinger, der später so die Gespräche einschätzt: Ich denke, ich habe damit recht, wenn ich sage, die erste Suggestion für den Benelux aus unseren Gesprächen, die den föderativen Blöcken gewidmet waren, ausging. Benelux wird am 5. September 1944 ins Leben gerufen.
Durch seinen Bekanntenkreis hat Retinger die Gelegenheit, die wichtigsten internationalen Anführer zu treffen. Einige Worte mit Averell Harriman sind ausreichend, um in die USA geschickt zu werden, und dank Retingers Erläuterungen dort drüben mit Dean Acheson, wird der Marshallplan geboren, der durch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OEEC) als der erste Schritt zur europäischen Integration gilt. Retinger stets gut verborgen hinter vielen besser bekannten Persönlichkeiten.
Zurück zum Jahr 1941. Im März fährt Sikorski mit Retinger in die USA und Kanada. In Washington trifft General Sikorski auf Präsident Roosevelt und informiert ihn über die Plane der Föderation in Mittelosteuropa. Roosevelt unterstützt den Plan. Während der Gespräche gelingt Retinger, die Zusage für eine Hilfe von 12 Millionen Dollar für die polnische Widerstandsbewegung zu bekommen. Das Geld sollte aus dem Lend-Lease Bill von 11. März 1941 kommen, dem wichtigsten Mittel, um den ausländischen Nationen während des Zweiten Weltkrieges, bei Einhaltung der Neutralität der Vereinigten Staaten, die US-Militärhilfe zur Verfügung zu stellen. Primär sollte es Hilfe für Großbritannien sein, andere alliierte Staaten sind bald in dieses Gesetz eingeschlossen.
Zurück in London treffen sich Sikorski und Retinger mit Sir Richard Stafford Crips, dem britischen Botschafter in Moskau. Crips kommt nach London, um über die, seiner Meinung nach, bevorstehende Aggression Hitlers gegen die Sowjetunion zu informieren.
General Sikorski ist überzeugt, dass es an der Zeit ist, diplomatische Beziehungen zu der Sowjetunion zu reaktivieren, weil ein bedrohtes Land ein zugänglicherer Partner für Verhandlungen und Gespräche sein wird.
Am 22. Juni 1942 beginnt die Umsetzung des Barbarossa-Planes. Ein Tag nach der Invasion hält Sikorski eine Rundfunk-Rede, in der er zu einer Verständigung aufruft. In der Tat ist die Antwort seitens Moskau schnell und bald kommt es zu Gesprächen, an denen General Sikorski, Anthony Eden, Iwan Majski und Josef Retinger teilnehmen. Binnen eines Monats, am 30. Juli 1941, wird die Vereinbarung von Sikorski und Majski unterschrieben. Zugegen ist Winston Churchill, der zum Schluss sagt: Ich bin zuversichtlich, dass diese Vereinbarung das Ende der 300 Jahre währender Uneinigkeit zwischen Russen und Polen bedeuten wird. Dieses Blatt Papier, das vor uns liegt, beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte und bei diesem Beginn bin ich ein Zeuge.
In Zusammenhang mit dieser Vereinbarung kommt es zu einer Wende in der Exilregierung: drei Minister treten zurück und Präsident Raczkiewicz will die Vereinbarung nicht unterschreiben. Sikorski sieht allerdings in dieser Vereinbarung die Anerkennung Polens als Gegenstand des internationalen Rechts durch Stalins.
Der nächste Schritt ist das Unterschreiben am 14. August 1941 in Moskau einer polnisch-sowjetischer militärischen Zusatzvereinbarung, die schon im Pakt Sikorski-Majski9 von 30. Juli 1941 angekündigt war. Diese Militär-Vereinbarung sollte die Befreiung der hunderttausenden Polen regulieren, die in den Arbeitslagern und Gefängnissen der Sowjetunion gefangen sind. Die Vereinbarung umfasst auch die Schaffung einer Armee unter der Führung von General Anders10 und deren Evakuierung nach Iran. In Kuibyschew entsteht die polnische Botschaft, der Botschafter wird Stanislaw Kot, von Retinger unterstützt.
Retinger reist nach Moskau, um die Abwicklung der Vereinbarung zu begleiten, bis der Botschafter kommt. General Anders beschreibt das so in seinen Erinnerungen:
„Vorübergehend kam nach Moskau als charge d’affaires Josef Retinger, persönlicher Freund von General Sikorski. Retinger kennt die ganze Welt, es ist ein außergewöhnlich intelligenter und gewinnender Mensch. Hat mich mit dem britischen Botschafter, Sir Stafford Crips, den er schon lange kannte, bekannt gemacht. Ich glaubte, sogar Crisp, der sehr gut orientiert war in allen politischen Angelegenheiten, nicht so gut die Sowjets verstehen konnte. Von meiner Seite habe ich Retinger mit einer Reihe sowjetischer Politiker bekannt gemacht und seine Gespräche mit ihnen waren sicher für die polnische Sache günstig…“
Retinger schreibt über diese Zeit Folgendes: „Meine Hauptaufgabe bestand darin, alles zu unternehmen, um polnische Gefangene, die 1939 in die Sowjetunion verschleppt wurden, zu befreien. Ich muss sagen, in den sechs Wochen meines Aufenthaltes in diesem Land, waren die Russen sehr zuvorkommend und zeigten sehr viel guten Willen, damit alle Vereinbarungen und Versprechungen eingehalten werden. Gerade als ich nach Archangelsk kam, hatte der Rundfunk im ganzen Land bekannt gemacht, dass die Polen befreit werden sollten und ohne Hindernisse reisen sollten, so dass sie ihre Botschaft kontaktieren konnten und mit ihren Familien zusammenkommen und zu der sich bildenden polnischen Armee stoßen könnten.“
Im Oktober reist Retinger mit Sikorski und Major Victor Cazalet, dem Abgeordneten im britischen Parlament und persönlicher Verbindung zwischen Churchill und Sikorski, nach Kuibyschew, wo sie auf General Anders und Botschafter Kot treffen und dann gemeinsam nach Moskau fahren, um an Gesprächen mit Stalin teilzunehmen. Die Gespräche haben einen sehr positiven Ausgang.
Die Bildung der polnischen Armee in der Sowjetunion verläuft gut, mit einer Ausnahme. Sikorski und Retinger suchen ohne Erfolg mehrere tausend Offiziere in drei Internierungslagern. Sowjetische Regierung verweigert jede Information zu diesen Offizieren. Bis zum Jahr 1943, als das deutsche Rundfunk die Nachricht über den Fund der Massengräber bei Katyń bringt. Die polnische Exilregierung fordert Informationen, was dazu führt, dass Moskau die diplomatischen Beziehungen abbricht.
Weitere Kriegsjahre zeichnen sich durch rege politische und diplomatische Tätigkeit von Retinger an Seite von Sikorski.
Februar des Jahres 1943 – Niederlage der Wehrmacht bei Stalingrad und zugleich der Sieg Stalins über die Wehrmacht – das ist die Zeit, in der Stalins Macht und Gewicht in der antideutschen Allianz entscheidend gestärkt werden. Die Engländer beginnen einen stärkeren Druck auf Sikorski auszuüben, damit er seine Politik neu, prosowjetisch orientiert. Die Lage der polnischen Exilregierung wird zunehmend schwierig.
In dieser Zeit will Sikorski polnische Anders-Armee in Nahen Osten inspizieren. Er trifft in Kairo General Anders, fährt weiter nach Bagdad und Beirut, um mit weiteren Feldherren die neue Lage Polens zu erörtern. Auf dem Rückweg fliegt er nach Gibraltar, wo er weitere Truppen besucht. Kurz nach dem Start Richtung London, versagt das Flugzeug und der General und begleitende Personen kommen ums Leben. Retinger erwartet Sikorski auf dem Flughafen Swindon. Am frühem Morgen erfährt er vom Tod des Generals. Am nächsten Tag fliegt er in Begleitung General Ujejski nach Gibraltar, um seinen Leichnam nach London zu bringen. Die polnische Exilregierung beschließt, nach Beendigung des Krieges, die Überreste nach Polen heimzufahren und auf der Burg Wawel beizusetzen. Das kann erst im Jahr 1993 geschehen!
Die Trauerfeierlichkeiten finden in der Westminster Kathedrale statt, beerdigt wird er auf dem Friedhof der polnischen Flieger in Newark.
Sikorkis Tod war für Retinger ein großer Schock und ein schmerzhafter Verlust. Er hat einen Freund verloren und mit ihm die Chance, in Zukunft seine Pläne zu verwirklichen.
Im August 1943 erscheint im Times ein langer Artikel, in dem eine Aufteilung der Einflusssphären vorgeschlagen wird: östliche und westliche. Polen wird der östlichen – der sowjetischen – zugeteilt. Das ist die Zeit, dass der Westen zunehmend mit der Sowjetunion rechnen muss. Im November 1943 kommt in Teheran zum Treffen der Großen Drei. Dieses Treffen endet mit Vereinbarungen, die die polnische Souveränität wesentlich tangieren: Roosevelt und Churchill sind mit Stalins Vorschlag einverstanden, die Ostgrenze von Polen auf der Curzon-Linie11 zu errichten. Beide denken wohl, dass mit dieser Konzession eine Garantie der Souveränität Polens erkauft werden kann.
In Angesicht der neuen politischen Lage versucht die polnische Exilregierung, mit der Führung des Untergrunds im okkupierten Land Kontakt aufzunehmen, um die Einstellung der Generelle der Untergrund-Armee in Erfahrung zu bringen: Ob man den Lauf der Ereignisse umkehren kann oder ob es ratsam ist, sich dem Schicksal zu ergeben.
Diese Herausforderung nimmt auf sich Josef Retinger, der die meiste Kompetenz und die meisten Beziehungen sowohl im Westen als auch in Polen besitzt. Des Gewichts der Mission und ihrer Gefährlichkeit ist sich Retinger sehr wohl bewusst.
Colin Gubbins, Chef der Strategic Office Executive, einer geheimen Organisation, die die Widerstandsbewegung in ganz Europa koordiniert und unterstützt, legt die konkreten Pläne der Expedition fest: Retinger wird mit dem Fallschirm über dem okkupierten Polen abgeworfen und am Ende der Mission wird er von einem Flugzeug aufgenommen und zurück nach England gebracht. Die Aktion sollte in Bari in Italien beginnen. Begleitet wird Retinger von Marek Celt, der die Bedingungen des Untergrundes gut kennt. Am 3. April 1944 startet das Flugzeug. Im frühen Morgenstunden kommt zu dem entscheidenden Moment – zum Sprung mit dem Fallschirm. Beide landen glücklich und nach drei Kilometer Marsch erreichen sie das Ziel – Dębie Wielkie bei Mińsk Mazowiecki. Die zwei Springer und 22 vom Flugzeug abgeworfene Behälter werden von Soldaten der Untergrundarmee abgeholt.
Die Hauptaufgabe von Retinger ist auszuloten, ob es Bedingungen für eine Verständigung des Untergrundes mit den polnischen Kommunisten gibt, um nach dem Krieg eine Regierung von Premierminister Mikołajczyk zusammen mit den Kommunisten zu etablieren.
Nach der Ausführung der Mission, nach vielen Komplikationen und Gefahren, verlässt er auf gleichem Wege das polnische Territorium Richtung Brindisi. Außer den Dokumenten nimmt er Teile einer V-2 Rekete mit, die – nicht explodiert – von den Soldaten der Untergrundarmee gefunden wurde. Zusammen mit Retinger flog Tomasz Arciszewski nach London. Er wird nach der Dimission von Mikołajczyk 1944 Premierminister der Exilregierung. Von Brindisi fliegt Retinger nach Kairo, wo er mit Mikołajczyk zusammen trifft.
In Polen beginnt der Warschauer Aufstand, infolge dessen die Stadt vollkommen zerstört wird.
In Jalta wird die Zukunft Europas besiegelt.
In Lublin wird die neue prosowjetische polnische Regierung ins Leben gerufen. Die Exilregierung ist marginalisiert.
In den Jahren 1945 und 1946 fliegt er noch drei Mal nach Warschau; er bringt Hilfe im Wert von vielen Millionen Pfund. Das ist Hilfe für das Land und zugleich eine propagandistische Unterstützung für Mikołajczyk, der zunehmend von den Kommunisten verdrängt wird. Diese Ausflüge finden ihr Ende, als die Kommunisten ihre Macht sichern.
In diesen zwei Jahren widmet sich Retinger auch anderen Aufgaben, die fortan seine Hauptbeschäftigung werden: dem Bau des vereinten Europas. Das Thema ist nicht neu. Schon im Jahr 1946 beruft Retinger in Brüssel die Unabhängige Europäische Liga für Wirtschaftliche Zusammenarbeit6 ins Leben. Sie wird 1948 Gründungsmitglied der Europäischen Bewegung.
Im Mai 1948 findet der gewaltige »Congress of Europe« in Den Haag statt. Die privat initiierte Konferenz bringt verschiedene Gruppen der europäischen Einheitsbewegung zusammen. Das Präsidium des Kongresses wird Churchill angetragen. Unter seiner Schirmherrschaft diskutierten über 700 Europäer, unter ihnen 18 ehemalige Premierminister und 28 ehemalige Außenminister, über die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen eines geeinten Europas. Dieser Kongress wird von vielen als die erste föderalistische Bewegung der europäischen Geschichte betrachtet. Wie einer von Retingers Freunden (Denis de Rougemont, ein schweizerischer politischer Philosoph und Vorkämpfer der europäischen Integration) später berichtet, ist es in Wirklichkeit Retinger, der hinter dem Kongress steckt. Die wichtigsten Themen, mit denen sich der Kongress in Den Haag beschäftigt, sind die Notwendigkeit einer Weltföderation, mit dem ersten Schritt eines Vereinten Europas; weitere Themen sind ein notwendiger Austausch von historischen Schulbüchern, da die Kinder Geschichte aus einem viel breiteren europäischen Blickwinkel gelehrt werden sollten, nicht mehr ausschließlich von der nationalen Seite. Dieser Kongress das ist der Beginn der Vereinigung der europäischen Staaten. Er trägt reiche Früchte: Das Europäische Rat, Europäische Bewegung, Das Europäische Kulturzentrum in Genf und Das Europäisches Kollegium in Brüggen.
Wilde Spekulationen um weltweite Verschwörung ruft Retingers nächste Initiative hervor – die Bilderberg12-Konferenz, die sich bis heute einmal im Jahr versammelt. Außer der Kenntnis um die regelmäßigen Treffen, weißt die Welt nicht viel darüber, was wiederum ein weiterer Grund für abstruse Vermutungen ist. Diese Gruppe entsteht aber aus der Einsicht, dass alle existierenden Streitigkeiten und die Gefahr einer Ausspielung von Kreml notwendig dazu führen müssen, dass die wichtigsten Persönlichkeiten der Politik, der Kultur, der Wirtschaft, sich in einem Club organisieren, in dem man die Fragen in einer informellen und diskreten Atmosphäre erörtern könnte.
Retinger nutzt alle seine Kontakte und im Jahr 1954 kommt es zu dem ersten Treffen im Hotel Bilderberg – von dem die zyklischen Treffen ihren Namen nehmen – bei Arnheim in Holland. Retinger will auch noch etwas anderes erreichen: dass durch diese Zusammenkünfte der wichtigen Persönlichkeiten von beiden Seiten des Atlantiks dem Antiamerikanismus in Europa und dem Antieuropäismus in den Vereinigten Staaten entgegen gewirkt werden kann. An dem ersten Treffen nehmen Politiker, Industrielle, Finanzleute, Wissenschaftler, Vertreter des Hochadels, der Geheimdienste, mit einem Wort, die einflussreichsten Persönlichkeiten aus Amerika und Europa, teil. Die Teilnehmerlisten werden im Nachhinein bekannt gegeben, nicht jedoch die Gesprächsthemen. Und so bleibt es bis heute. Wichtig für diese Gesprächsplattform ist es, jeweils zwei Personen aus den bedeutenderen europäischen Staaten zu finden, um so den konservativen und liberalen Blickwinkel offenzulegen. Die Bedeutung der Treffen wächst vom Jahr zu Jahr. Die Einladung zu dem Treffen wird als eine Bestätigung des internationalen Ranges der eingeladenen Person verstanden.
Die Organisation der Gruppe um den Prinz Bernhard als Vorsitzenden ist ein großer Erfolg von Retinger. In der Struktur der Gruppe nimmt er die Funktion als Generalsekretär. Im Jahr 1956 gibt Retinger eine Ausarbeitung The Bilderberg Group heraus, in der er die Ziele der Organisation darlegt und eine Bewertung der bisherigen Arbeit vornimmt. Des Weiteren bringt er eine Liste der 159 Teilnehmer.
Im Jahr 1960 stirbt Josef Retinger.
50 Jahre nach seinem Tod ist der Zusammenhalt der Atlantischen Welt ungewiss. Allen voran befinden sich die USA und Großbritannien in einer historischen Krise.
Obwohl es in Europa seit Jahrhunderten verschiedene übernationale Staatsgebilde gab, ist die Europäische Union deshalb etwas Besonderes, weil sie erstens in der Zeit des nationalen Bewusstseins der europäischen Länder zustande kam und zweitens inzwischen die meisten Länder Europa umfasst. Die bisherige Weltmachtstellung der USA befindet seit dem verlorenem Irak-Krieg im Abnehmen. Außer anderen Folgen hat dieser Prozess auch die Konsequenz, dass es den Europäern bewusst wird, dass Europa nicht zerfallen darf, sonst werden die einzelnen Länder, trotz ihrer Wirtschaftsstärke, unbedeutend und somit dem freien Spiel der aufkommenden Mächte ausgesetzt.
Die angelsächsischen Staaten, USA und Großbritannien, befinden sich, wohl unabhängig von einander, in einer gefährlichen Krise: Die Vereinigten Staaten drohen in den für sie fast natürlichen Zustand der Isolation von der restlichen Welt zu fallen und Großbritannien steht durch den Brexit erst am Anfang einer Krise mit ungewissem Ausgang.
Der amerikanische Isolationismus ist ein Zustand, nach dem die USA als Staat unwillkürlich streben. Nur eine erkannte Gefahr und eine Willensanstrengung können das Land von diesem Weg zur Umkehr zwingen. So war es nach allen Kriegen, die Amerika ausgefochten hat: beginnend mit der Unabhängigkeitskrieg am Ende des 18. Jahrhunderts, über den Sezessionskrieg, den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg. Und jetzt wieder. Im 20. Jahrhundert ist der Hang zum Isolationismus deshalb durchbrochen worden, weil die Gefahr, dass amerikanische Hegemonie im Atlantik-Raum einmal durch Deutschland durchbrochen und einmal durch die Sowjetunion bedroht werden könnte.
Seit dem Ende des Kalten Krieges und dem Untergang der früheren Sowjetunion trägt die Weltordnung den Namen „Pax Americana“, was den amerikanischen Gestaltungsanspruch zum Ausdruck bringt.
Und diese Pax Americana ist jetzt bedroht durch die abnehmende Stärke der USA, allen voran die militärische Stärke. Die amerikanische Wirtschaft muss es jetzt mit der chinesischen aufnehmen. Weil es so viele Kräfte bündelt, kann USA nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, auch Geld, der atlantischen Welt widmen. Angela Merkel hat den Epochenbruch, die Abkehr von der transatlantischen Orientierung der USA erkannt, indem sie sagte: „Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei.“ Sie sagte weiter: „Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen.“
***
Die Wurzeln Europas –
Christentum, griechische Philosophie, römisches Recht

Und da sind wir wieder in Europa Anfang des 21. Jahrhunderts. Nach einer bangen Zeit der zweiten Hälfte des Jahres 2016 und der ersten Hälfte 2017 besteht jetzt wieder berechtigte Hoffnung, dass Europa grundlegend seine Zukunft neu gestalten kann. Nach dem Brexit im Juni 2016 erfasste eine große Verunsicherung das Kontinent. In so einem vergifteten Klima wucherten Nationalismen und die Stimmung drohte endgültig umzukippen. Durch den Wahlsieg in Österreich und in Holland ist das Vertrauen langsam zurückgekehrt, aber erst der Sieg von Emmanuel Macron erlaubt wieder eine berechtigte Hoffnung, dass Europa sich erneuert, dass es zu einer neuen Stärke erwächst, dass es durch die Krisen der letzten Jahre umso stärker werden wird.

Angesichts dessen, dass heutige politische und wirtschaftliche Lage tausendfach günstiger ist, als sie damals – während und unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – gewesen war, bin ich überzeugt, dass die Erneuerung der Europäischen Union bald beginnen und, so gut wie sicher, zu einem Erfolg führen wird. Was ich nicht glaube, ist, dass die Politiker, die wir tagtäglich sehen und hören, sogar der talentierte Monsieur Macron und die erfahrene und kluge Frau Merkel, eine entscheidende Änderung in Europa herbeiführen können. Ich bin überzeugt, dass, so wie in allen bedeutenden Momenten der Weltgeschichte, im Hintergrund Menschen wirken, von denen die Öffentlichkeit kaum etwas erfährt, die aber einen maßgebenden Einfluss auf die Abläufe der zeitgenössischen Entwicklung in der westlichen Welt haben werden.

In den fast 2000 Jahren der europäischen Geschichte waren die großen Gestalten am einflussreichsten, die im Namen des Christentums gewirkt, ohne unbedingt darüber geredet zu haben, die moderne Geschichte seit der Aufklärung nicht ausgenommen. Die Aufklärung und die Französische Revolution hatten zwar die sichtbare Macht der Kirche als Institution erheblich beschnitten, und zu recht beschnitten, jedoch zur Absorption der jüdisch/christlichen Werte in der Gesellschaft geführt. So sind zum Beispiel Menschenrechte, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, aber auch Inividualismus auf das Bild des Menschen im Alten und Neuen Testament zurückzuführen – charakteristisch ausschließlich für Judaismus und Christentum, und somit für Europa und die westliche Welt – und finden sich nicht in anderen Wertesystemen.
Ein Symbol der Union ist die blaue Europaflagge mit goldenen Sternen. Die Idee13 zur Europaflagge kam einem Belgier jüdischer Abstammung, der nach dem Krieg zum Katholizismus konvertiert war, Paul Lévi, Leiter der Kulturabteilung des Europarats, im Jahr 1955, beim Anblick einer Marienstatue, die wiederum eine Anspielung auf die Imagination aus der Apokalypse von Johannes ist: „Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau mit der Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt.“ (Offenbarung des Johannes 12,1): die Farbe des Himmels und die goldenen Sterne.

Bekannt ist, dass viele der europäischen Anführer aus ihren christlichen Überzeugungen Inspiration und Leidenschaft in ihrer Arbeit für die Europäische Einheit zogen. Auch Josef Retinger. Übrigens, fast alle Staatsmänner – Adenauer, Robert Schuhman, Bech, Bidault, De Gasperi und v. Zeeland –, die sich für ‚Europa’ zu jener Zeit engagierten, gehörten der spanischen Laienorganisation Opus Dei an.
Christentum, griechische Philosophie, römisches Recht – alle drei sind sie die wahren Wurzeln Europas.
***
Anmerkungen:
1. Olgierd Terlecki, Kuzynek diabła, Kraków 1988
2. Olgierd Terlecki, Kuzynek diabła, Kraków 1988
3. https://de.wikipedia.org/wiki/Österreich-Ungarn
4. https://de.wikipedia.org/wiki/Europarat
5. https://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Freihandelsassoziation
6. https://de.wikipedia.org/wiki/Ligue_Européenne_de_Coopération_Economique
7. https://de.wikipedia.org/wiki/Opus_Dei
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Intermarium
9. https://de.wikipedia.org/wiki/Sikorski-Maiski-Abkommen
10. https://de.wikipedia.org/wiki/Władysław_Anders
11. https://de.wikipedia.org/wiki/Curzon-Linie
12. https://de.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-Konferenz
13. https://www.welt.de/print-welt/article625491/Der-Sternenkranz-ist-die-Folge-eines-Geluebdes.html
Bibliografie:
1. W. Chr. Taverne, Józef Retinger und das Heilige Römische Europa, Was steckt hinter der Europäischen Einheit, Einige Fakten über Joseph H. Retinger und seine Aktivitäten, 1880-1960
2. Włodzimierz Kalicki, Retinger, gracz, który budował Europę, 2010
3. Jacek Dobrowolski, Józef Hieronim Retinger. Wielki nieobecny – legenda a rzeczywistość, 2010
4. Jeremi Sadowski, Józef Retinger i jego amerykańska teczka, 2008
5. Bogdan Podgórski, Józef Hieronim Retinger 1880-1960
6. Olgierd Terlecki, Kuzynek diabła, Kraków 1988